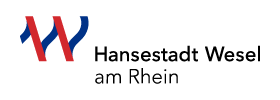Mittelalter bis 16. Jahrhundert Die Überlieferung des Stadtarchivs reicht bis in das Jahr der Stadterhebung 1241 zurück. Aus den ersten acht Jahrzehnten der Stadtgeschichte sind nur Urkunden überliefert. Die älteste Handschrift stammt aus dem Jahr 1322, die älteste Stadtrechnung von 1349. Die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Bestände bestehen v.a. aus Amtsbüchern, Stadt- und Stiftungsrechnungen, Ratsprotokollen, Briefbüchern sowie Sammlungen von Privilegien und Verordnungen. Akten gibt es, bis auf wenige Ausnahmen, erst seit der zweiten Hälfte des 16. Jhrs. Untergebracht war das Archivgut spätestens seit der zweiten Hälfte des 15. Jhrs. im spätgotischen Rathaus (1456-1945). Der zweite Anbau, für den die Stadt 1590 ein am Fischmarkt gelegenes und an das Rathaus angrenzendes Haus ankaufte, diente ebenso der Unterbringung des Archivs. Die Sammlung verweilte auf zwei Etagen und reichte möglicherweise, längs durch die beiden Anbauten, vom Großen Markt bis zum Fischmarkt. Wo das Archivgut vorher untergebracht war, ist nicht mit Sicherheit festzustellen. Eine Archivierung im ersten Rathausbau (1386-1456) ist wahrscheinlich. Vorher und möglicherweise schon im 14. Jhr. lagerte das städtische Schrifttum im Dominikanerkloster.
17. Jahrhundert Erstmals verzeichnet wurden die Archivalien in der ersten Hälfte des 17. Jhrs. Bürgermeister Dr. Anthon ter Smitten, Schöffe Dr. Dietrich von der Brüggen und Stadtsekretär Dr. Johann von Raesfeld stellten die Ergebnisse nach jahrelanger Arbeit 1644 dem Rat vor. Neben den städtischen Amtsbüchern und Akten verzeichneten die drei Amtsträger auch die Unterlagen der von der Stadt verwalteten bzw. beaufsichtigten Kirchen-, Schul- und Armenstiftungen sowie das Schriftgut der ebenfalls im Rathaus residierenden Gerichte. Das Findbuch wurde mit genügend Platz für eine Fortschreibung angelegt. Eingetragen wurden allerdings nur die drei folgenden Jahre. In den 1680er Jahren wurde der Bestand erneut in einen ordentlichen Zustand versetzt, wofür der damit beauftragte Gehilfe des Stadtsekretärs nach eigenen Angaben zwei Jahre benötigte.
18. Jahrhundert Wie das Archiv danach geführt wurde, lassen gut ein halbes Jahrhundert später Klagen über die Unordnung im Archiv erahnen. Die besonders während der Zeit des Stadtsekretärs Dr. Jodocus Becker (1709-1753) augenfälligen Missstände mussten seine Nachfolger bereinigen. Wilhelm Daniel Cramer (1753-1759) erhielt zu Beginn seiner Tätigkeit die Anweisung, zumindest die laufende Registratur innerhalb von drei Monaten in einen akzeptablen Zustand zu versetzen und ein Repertorium anzufertigen. Cramer kam der Anordnung nach, wenn auch nicht in der gewünschten Zeit. Das Archiv selbst befand sich jedoch weiterhin in derartiger Unordnung, dass 1774 die Sekretäre Friedrich Wilhelm Gantesweiler (1760-1783) und Conrad Duden (1783-1792) damit begannen, das Archiv erneut zu ordnen und die losen Blattsammlungen zu heften oder zu binden. Das neue Repertorium von 1791 listet im ersten Teil die Aktenbestände auf, im zweiten Teil die Ratsprotokolle, Edikte, Rechnungen, Wochenbücher, Belege und Konzepte, Gerichtsprotokolle sowie die Intelligenzblätter. Ein weiteres, 1792 von Conrad Duden vorgelegtes Repertorium erfasst in drei Teilen die Kirchen-, Schul- und Stiftungsregistratur sowie die Reste der Stiftungsurkunden.
19. Jahrhundert Die im Rathaus befindlichen Gerichtsunterlagen mussten 1808 teilweise an das Staatsarchiv Düsseldorf abgegeben werden. Das nicht dahin verbrachte Archivgut (u.a. Schöffenprotokolle, Rechnungen, Konzepte und Belege) wurde auf Befehl des Bürgermeisters Matthias Daniel Christian Adolphi gewinnbringend als Altpapier verkauft. Ein weiterer Verlust resultierte aus der Abgabe an das Evangelische Kirchenarchiv Wesel im Jahr 1853. Die Gemeinde erhielt zahlreiche Archivalien, darunter die Rechnungen der beiden Stadtkirchen Willibrord (1401-1794) und Mathena (1434-1807), mittelalterliche Kopiare und Einkünfte-Verzeichnisse sowie einige Stiftungsbriefe. Das Gros der damals noch unverzeichneten Urkunden blieb allerdings bei der Stadt. 1877 gab die Stadt ihr Archiv nach langwierigen internen Diskussionen als Depositum an das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf ab. Dort bot ein neues und feuersicheres Gebäude die Möglichkeit, Kommunal- und Gemeindearchive sicher zu verwahren. Während der Unterbringung in Düsseldorf wurde das Weseler Depositum wissenschaftlich genutzt und v.a. der komplette Urkundenbestand verzeichnet.
20. Jahrhundert In den späten 1930er Jahren bemühte man sich um die Rückführung des Archivs. Treibende Kraft war der Museumsleiter und spätere Stadtarchivar Adolf Langhans. Nach zähen Verhandlungen mit dem Staatsarchiv und dem Ministerium kehrten die Archivalien 1943 nach Wesel zurück. Untergebracht wurden sie im Herzogsschloss, wo sich das von Langhans geleitete Niederrheinische Museum für Orts- und Heimatkunde befand. Ende 1944 wurden die Urkunden, ältesten Handschriften, Amtsbücher und Akten sowie die Findbücher ausgelagert und in ein Salzbergwerk bei Volpriehausen transportiert. Dort kam es zu Plünderungen durch Zwangsarbeiter und im Juni 1945 zu einer Explosion, bei der die Archivalien zum größten Teil vernichtet wurden. Gerettet wurden lediglich einige verunreinigte und beschädigte Handschriften, 283 städtische Urkunden und rund 150 Stiftungsurkunden.
Das in Wesel verbliebene Archivgut sowie auch die Bestände der Weseler Kirchen lagerte die Stadt Ende 1944 im Haupttorgebäude der Zitadelle. Die Bombardierungen überstanden sie. Erst nach dem Einmarsch der Alliierten kam es zu Verlusten und Beschädigungen durch Plünderungen. Gesichert wurden die Akten daraufhin im Keller der Schule an der Blücherstraße. Von dort transportierte die Landesarchivverwaltung sie im August und September 1945 ins Schloss Kalkum. Dort blieben die Akten bis 1946 unter der Obhut des Staatsarchivs und wurden dann in das Zentraldepot der Archivverwaltung nach Schloss Gymnich bei Kerpen umgesiedelt. Dies war allerdings eine Behelfsunterkunft, sodass man sich ab 1951 um eine neuerliche Rückführung bemühte.
Die Stadt erklärte sich bereit, im neuen Rathaus zwei Keller mit gut 75 Quadratmetern bereitzustellen. Die Räume konnten 1952 bezogen werden. Das Rathaus war zu diesem Zeitpunkt erst teilweise fertiggestellt. Archivleiter wurde nach dem Tod von Adolf Langhans im Oktober 1953 der Bibliothekar Dr. Gerhard Metzmacher (1954-1963). Zu den vordringlichsten Aufgaben gehörten die Bestandsaufnahme samt Erstellung neuer Findmittel sowie die Verbesserung der Unterbringung. Das Archivgut litt im Rathauskeller nicht nur wegen der klimatischen Bedingungen, sondern auch aufgrund von Fraßschäden durch Mäuse und infolge eines erheblichen Wasserschadens während der Bauarbeiten. Die Zustände verbesserten sich auch nicht, als das Archiv 1971 nach dem Verkauf des Rathausgeländes an die Warenhauskette Kaufhof provisorisch in den Keller der Schule an der Rheinbabenstraße umzog. Dem neuen Stadtarchivar Heinz Kirchmann (1966-1981) stand dort mehr Platz zur Verfügung, aber auch diese Räume boten ungünstige klimatische Bedingungen. Zudem verliefen Wasserrohre an der Decke, an denen Wasser kondensierte und abtropfte. Immerhin verzeichnete das Archiv in diesen Jahren beträchtliche Zuwächse. So wurden im Zuge der kommunalen Neugliederung 1969-1975 die Bestände der Gemeinden Obrighoven-Lackhausen, Flüren, Büderich, Bislich, Diersfordt und Blumenkamp sowie die stattlichen Reste der Bibliothek des ältesten Weseler Gymnasiums mitsamt den erhalten gebliebenen Teilen der Heresbach-Bibliothek übernommen. 1969 begann zudem die von der Archivberatungsstelle Rheinland durchgeführte Sicherungsverfilmung der Hauptbestände. 1974 wurden die Magazinkeller im heutigen Rathausbau bezogen, die mit 360 Quadratmetern sehr geräumig, aber klimatisch nach wie vor nicht akzeptabel waren. Trotz aller Proteste liefen weiterhin Wasserleitungen durch den Raum. Es bildete sich Kondenswasser und mit der Zeit leckten die Leitungen so stark, dass man eine Dachrinne installieren musste. Die Büros und die beengten Arbeitsplätze der Benutzer befanden sich im ersten Untergeschoss.
Mit Dr. Jutta Prieur-Pohl (1982-1998) übernahm erstmals eine ausgebildete Archivarin die Leitung. Neben der Verbesserung der Unterbringung, der Systematisierung, Aufnahme und Verzeichnung der Bestände sowie einer verstärkten Öffentlichkeitsarbeit gehörte die Restaurierung der angegriffenen Bestände und Gymnasialbibliothek zu den dringlichsten Aufgaben. Es entstanden ein Zeitungskeller und ein Benutzerraum. Die klimatischen Bedingungen wurden durch den Einbau einer Luftwechselanlage verbessert, die jedoch die vorgegebenen Klimawerte nicht erreichte. Zwischen 1991 und 2000 gab es 21 Wassereinbrüche mit bis zu fünf Zentimetern Wasserstand. Die Folge waren Schäden an den Beständen und Regalen, die zu rosten begannen und sich verzogen. Daher wurden 1991 die wertvollsten Archivalien ins Kreisarchiv Wesel evakuiert. Sie blieben zwei Jahre dort, bevor sie in einen neuen Magazinraum eingelagert wurden. Die Archivverwaltung wechselte 1992 ins Haus Eich gegenüber dem Rathaus. Der Benutzerraum zog in ein ehemaliges Büro und hatte nun Tageslicht, bot allerdings nur noch Platz für vier Personen. Der Höhepunkt der Zersplitterung des Archivs war 1997 erreicht, als nach erneuten Wassereinbrüchen die Auslagerung des Altbestandes in das Haupttorgebäude der Zitadelle und in einen Keller des Rathausanbaues erfolgt war. Im Keller konnten die Akten nur gelagert, aber nicht genutzt werden.
Seit dem Ende der 1980er ist das Stadtarchiv zusammen mit dem LVR-Niederrheinmuseum, dem Stadtmuseum und der Jugendmusik- und Kunstschule Bestandteil des Projekts „Kulturzentrum Zitadelle“. 1994 wurde es aus dem Haupt- und Personalamt ausgegliedert und ist seitdem ein eigenständiges Amt. Vier Jahre später fasste der Stadtrat den Beschluss, die ehemalige Baeckerey in der Zitadelle zum neuen Stadtarchiv auszubauen. In diesem Jahr übernahm Dr. Martin Roelen (1998-2023) die Leitung des Archivs.
21. Jahrhundert Das aus fünf Tonnengewölben bestehende Gebäude wurde komplett entkernt und umgestaltet. Es erhielt einen neuen Boden und eine neue Decke, die den Anforderungen der Regalschiebeanlagen entsprechen und zusammen 775 Quadratmeter messen. Die denkmalgeschützte Bausubstanz blieb unberührt. Die beiden Magazinräume und der Aktenzugangsraum im Erdgeschoss (zusammen 316 Quadratmeter mit einem Lagerplatz von 3500 Regalmetern) sind klimatisiert. In ihnen sind alle Wasserleitungen, soweit möglich, in einem Bodenkanal verlegt. Die beiden Stockwerke sind durch eine knapp 200 Jahre alte Treppe und einen Aufzug verbunden. Im Rathauskeller stehen zudem weitere 1000 Regelmeter zur Verfügung.
Der eigentliche Umbau zum Archiv begann im Januar 2000 und wurde Ende September abgeschlossen. Der Umzug zum Jahreswechsel kam allerdings nicht zustande, da plötzlich massive Schimmelprobleme auftraten. Infolge einer defekten Dachentwässerung hatte das Mauerwerk viel Wasser aufgenommen. Das Problem konnte durch die Mithilfe der Archivberatungsstelle und einer Spezialfirma gelöst werden, sodass im Mai 2001 die Büros und der Lesesaal im oberen Stockwerk bezugsfertig waren. Die Magazinräume im Erdgeschoss konnten wegen einer feuchten Wand erst im Folgejahr bestückt werden. Nach dem Aufbau der Regale folgte die Einlagerung von gut 2000 Metern Archivgut. In drei Etappen wurden das Haupttorgebäude, das alte Hauptmagazin im Rathaus, der Zeitungskeller und ein Teil des zweiten Rathausmagazins geräumt. Damit wurde ein über sechs Jahrzehnte dauerndes Provisorium beendet und das Stadtarchiv endgültig Teil des Kulturzentrums Zitadelle. Im Jahr 2000 wurde es dem Kulturamt zugeordnet und gehört seit der Verwaltungsreform 2001 als Team Archiv zum Fachbereich 4 (Stadtkultur).