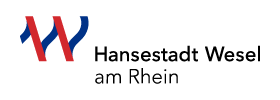Der im Foyer der Stadtbücherei verlegte Fußboden aus Kieselmosaik zierte bis Mitte März 1972 das Haus Hohenbusch. Es wurde nach einer der letzten Bewohnerfamilien auch „Pollmans Kate“ genannt.
Als das Wohnhaus in Obrighoven Anfang der 1970er Jahre zum Abriss freigegeben wurde, rettete eine Initiative aus Weseler Heimatforschenden, Denkmalpflegerinnen und Denkmalpflegern, dem Landes-konservator, einigen Handwerkern und der Rheinischen Post den Boden in letzter Minute vor der Zerstörung.
Haus Hohenbusch, ein beliebtes Motiv des Weseler Künstlers August Oppenberg, wurde nach 1738 als Fachwerk in den Lippeweiden errichtet. Heute lässt sich die Lage der Kate nur noch erahnen. Folgt man dem heutigen Verlauf der Straße „In der Luft“ in Richtung Lippe über die Brunnenstraße hinaus, gelangt man auf einen Feldweg, der heute im Nirgendwo endet.
Eine erste Erwähnung findet der Hohe Busch unter der Bezeichnung „Podixbusch“ als clevisches Lehn und ist zu dieser Zeit dem Gut Aap zugehörig. In Katasterkarten von 1731 bis 1738 ist der Hohe Busch in zwei Felder ohne Wohnbebauung aufgeteilt. Besitzer ist die im Jahr 1443 gegründete gemeinnützige Weseler Offermann-Stiftung.
Der Kieselboden wurde im Jahr 1797 von einem unbekannten Künstler mit viel kunsthandwerklichem Geschick aus ca. 30.000 Steinen zusammengesetzt.
Neben der Jahreszahl trägt er die Initialen
„J D M – A G D M“. Gemeint sind damit Johann und Anna Gertrud Dickmann, damalige Besitzer der Hofstelle. Der Boden könnte ein Hochzeitsgeschenk gewesen sein, was sich heute nicht mehr aufklären lässt.
Die Kate wechselte in den folgenden Jahrhunderten häufig den Besitzer und war zuletzt im Besitz des Landes NRW, genauer im Besitz des Wasser- und Schifffahrtsamtes Dorsten.
Nach einem Presse-Aufruf zur Rettung des Kieselbodens im Jahr 1972 bot der Steinmetzmeister Ludwig Kreusch aus Emmerich seine Dienste an. Meister Kreusch, Sohn eines Aachener Dombaumeisters, barg und restaurierte den Boden. Zunächst wurde dieser dann im Bauhof der Stadt zwischengelagert, ehe er im November 1974 seinen neuen Platz im Bildungszentrum vor dem Kornmarkt – bald „Centrum“ genannt – fand. Das Centrum wurde am 2. Januar 1975 eröffnet.
von Bastian Wilmsen
Quellen:
- Helmut Rotthauwe genannt Löns, Rathäuser in Wesel, Wesel 1974;
- RP, 08.01.1972 und 25.03.1972
- StAW A1-302-02 und N133
- Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland
- Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland, Kleve, Kataster AA 0647