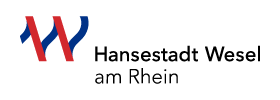1896 in Wesel-Lackhausen geboren, verbrachte Ida Tacke eine Kindheit in ländlicher Idylle. Ihr naturwissenschaftliches Talent wurde von den Eltern unterstützt, da sie hofften, dass Ida die elterliche Lackfabrik übernehmen würde. Ab 1915 studierte und promovierte Ida Tacke als eine der ersten Frauen in Deutschland im Fach Chemie in Berlin. Sie musste sich in einigen Vorlesungen als Mann verkleidet bewegen und schloss Wetten ab, ob es ihr gelingen würde, unerkannt zu bleiben. Bei den Wahlen zur Deutschen Nationalversammlung 1919 waren Frauen erstmals als Wählerinnen zugelassen. Ida Tacke flüchtete aus dem Krankenhaus, um ihr Stimmrecht auszuüben.
Der Wille zu forschen war der lebenslange Antrieb von Ida Tacke. Gemeinsam mit ihrem Mann, Walter Noddack, begab sie sich auf eine unermüdliche Suche, um das Periodensystem der chemischen Elemente zu komplettieren. Neben dem Studium der umfangreichen Literatur mussten Tonnen von Erzen bearbeitet und Proben ausgewertet werden, bis 1925 ein fehlendes Element entdeckt und nach ihrer rheinischen Heimat "Rhenium" genannt wurde.
In den 1920er und 1930er Jahren gelangen dem Forscherehepaar viele bahnbrechende Entdeckungen in der Photo- und Geochemie. Beide erforschten den Kohlenkreislauf, den Sehfarbstoff des menschlichen Auges, Nierensteine und deren Auflösung und entwarfen die "Allgegenwartstheorie der chemischen Elemente". Obwohl mehrfach für den Chemie-Nobelpreis vorgeschlagen, blieb dieser dem Forscherpaar - vielleicht auch wegen der politischen Lage - versagt.
1934 äußerte Ida Noddack-Tacke die damals sehr umstrittene Vermutung, dass Urankerne bei Neutronenbeschuss in Bruchstücke zerfallen können. Jahre später gelangen Otto Hahn, Fritz Straßmann und Lise Meitner auf diese Weise die erste Kernspaltung. Otto Hahn würdigte erst kurz vor seinem Tod die frühe Erkenntnis seiner Kollegin. Ihre Forschungen setzte Ida Noddack-Tacke bis ins hohe Alter an Universitäten und Forschungsinstituten fort. Sie starb 1978 in Bad Neuenahr.